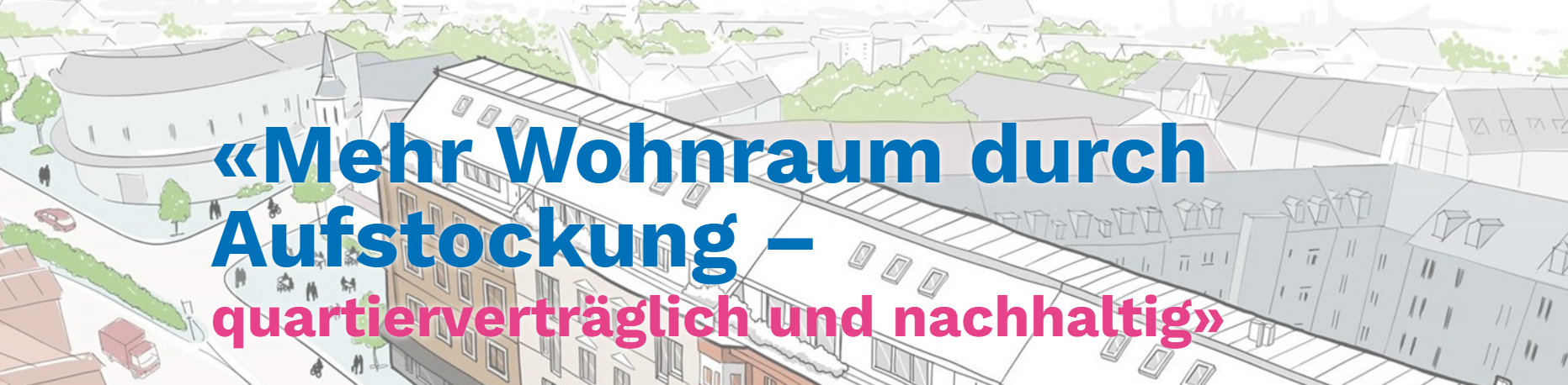Die FDP-Story: Verantwortung und Freiheit statt staatliche Bevormundung

Freisinn bedeutet, die Verantwortung eines jeden Einzelnen zu betonen und unnötige staatliche Eingriffe zu verhindern. Wir sehen zuerst Chancen und lassen uns von Hindernissen nicht entmutigen. Eigenverantwortung, Verantwortung und Freiheit sind für uns zentrale Werte. Dafür einzustehen, ist unsere Aufgabe.
Erfolg kennt kein Geschlecht und ist unabhängig von Alter und Herkunft. Darum stehen wir für diejenigen ein, welche Chancen wahrnehmen wollen. Die Schweiz ist erfolgreich, weil sie Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken und Handeln fördert und all jenen Chancen eröffnet, die mit ihren Fähigkeiten und ihrer Arbeit die Geschichte unseres Landes fortschreiben wollen. Die Basis dafür bildet eine starke Volksschule, ein durchlässiges Bildungssystem und die Forschungsfreiheit unserer Hochschulen.
Unternehmen und insbesondere KMU bilden gemeinsam das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und sind Motoren des Fortschritts. Ihnen muss Sorge getragen werden, damit sie nicht abwandern. Wir setzen uns konsequent für weniger Bürokratie, geringere Abgaben und Steuern ein, damit Unternehmen – ob klein oder gross – prosperieren und unsere Arbeitsplätze sichern können. Denn ihr Erfolg ist die Voraussetzung für den Wohlstand und die Zukunft der Menschen unseres Landes.
Wir wollen den Zugang zu Fachkräften aus dem In- und Ausland sichern, um unsere Wirtschaft stark zu halten. Doch die Zuwanderung ist aktuell zu hoch, auch aus der EU – sie sollte in Verhandlungen mit der EU besser gesteuert und reduziert werden. Es braucht bei der Personenfreizügigkeit deshalb ein griffiges Schutzkonzept. Zudem muss das Arbeitskräftepotential im Inland besser genutzt werden. Anerkannte Flüchtlinge nehmen wir auf und unterstützen sie bei der Integration. Die illegale Migration tolerieren wir nicht.
Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern eine Verpflichtung. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt. Mit innovativen Ideen und neuen Technologien sorgen wir für effektiven Umweltschutz und sichern so eine lebenswerte Umwelt für kommende Generationen.
Die Sicherung der Altersvorsorge ist dringlich. Wir setzen uns dafür ein, dass auch zukünftige Generationen eine sichere Rente haben. Durch gezielte Reformen und eine verantwortungsvolle Finanzpolitik stellen wir sicher, dass unsere Sozialwerke zuverlässig und leistungsfähig bleiben.
Freisinn ist Gemeinsinn. Wir engagieren uns für die Schweiz und den Kanton Zürich – beruflich, privat und mit Freiwilligenarbeit. Soziale Verantwortung ist für uns eine Verpflichtung.
Wir sind die FDP Kanton Zürich. Wir machen Zürich stark – seit 1894.

Der Mittelstand und unsere KMU sind die tragenden Säulen des Schweizer Erfolgsmodells. Sie stehen jedoch unter Druck wegen überbordender staatlicher Auflagen sowie steigender Abgaben und Steuern. Die FDP setzt sich für den Mittelstand und die KMU ein. Ebenso müssen wir den weltweit tätigen Unternehmen und guten Steuerzahlern Sorge tragen, die einen Grossteil der Steuerlast tragen.
Unsere Massnahmen:
- Staatliche Auflagen und Bürokratie reduzieren.
- Steuern und Abgaben für Unternehmen senken, um Arbeitsplätze zu sichern.
- Staat effizienter, schlanker und dienstleistungsorientierter gestalten, insbesondere durch konsequente Digitalisierung der Verwaltung.
- Abschaffung der Kirchensteuer für Unternehmen.
- Regelmässige Überprüfung und Abschaffung von Subventionen (Sunset Clause).
- Begrenzung des Staatswachstums und der Staatsstellen. Der Kanton Zürich soll sich sowohl bei den Privatpersonen sowie Unternehmen steuerlich unter den Top 10 der Schweiz befinden.
- Anreize für freiwilliges Weiterarbeiten nach der Pensionierung schaffen.
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern (Individualbesteuerung, Liberalisierung Sonntagsöffnungszeiten, Entbürokratisierung, bspw. bei übertriebenen Anforderungen für Kitas).
Wettbewerbsfähigkeit durch starkes Bildungssystem

Die Volksschule ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Die Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen stellt jedoch eine grosse Herausforderung dar. Wir setzen uns für eine erfolgreiche Volksschule ein, um unser duales Berufsbildungssystem zu sichern und die Gymnasialquote im Kanton Zürich auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren. Dies wiederum stärkt unsere Hochschulen als Spitzenstandorte für Forschung und Entwicklung.
Unsere Massnahmen:
- Reform der integrativen Schule.
- Deutschkenntnisse als Voraussetzung für die Teilnahme in Regelklassen etablieren.
- Bedarfsgerechte Frühförderung fremdsprachiger Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen und Entlastung der Regelklassen.
- Abbau der belastenden Bildungsbürokratie.
- Die Berufsmaturität soll den prüfungsfreien Eintritt in die Pädagogische Hochschule ermöglichen.
- Höhere Pensen in der Volksschule fördern, um die Anzahl Bezugspersonen in den Schulklassen zu reduzieren.
- Sicherstellung der Qualität in der Lehre und dem Schulbetrieb durch die laufende Integration von neuen Forschungsergebnissen und Best Practices.
- Tageschulstrukturen mit weniger kantonalen Auflagen und Bürokratie.
- Wettbewerbsfähigkeit unserer Hochschulen in Lehre und Forschung erhalten und ausbauen.
- Synergien zwischen Hochschulen, Start-ups und etablierten Unternehmen besser nutzen.
- Duales Berufsbildungssystem durch eine Aufwertung der Sekundarschule und der höheren Berufsbildung stärken sowie das Image der Lehre verbessern.
- Unternehmen als Rückgrat der Berufsbildung anerkennen und stärken. Stärkere Ausrichtung der Bildungsangebote auf den Arbeitsmarkt und Vermittlung praktischer Lebenshilfen wie z. B. Umgang mit Geld, ethisches Verhalten etc.
Zur Reform der integrativen Schule im Kanton Zürich:
www.fdpzh-freisinn.ch/2024/09/04/ist-die-integrative-schule-gescheitert/
Siehe auch, Positionspaper Bildung der FDP Schweiz:
Sicherheit für unsere Bevölkerung

Ohne Sicherheit keine Freiheit. Doch das Sicherheitsempfinden gerade im öffentlichen Raum, hat abgenommen. Wir sehen Bedrohungen durch Kriege, Terrorismus, Banden, mafiöse Strukturen und Cyberangriffe. Auch unsere Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen sind verletzlicher geworden. Wir müssen diesen Gefahren aktiv entgegentreten und die Sicherheit unserer Bevölkerung stärken.
Unsere Massnahmen:
- Strikte Anwendung des Strafrechts, raschere Verfahren und sofortige Vollstreckung von Urteilen, insbesondere bei Wiederholungstätern.
- Systematische Verfolgung von Kriminaltourismus, Konflikten unter Ausländergruppen, Hooligans und Wirtschaftskriminalität.
- Konsequente Polizeiarbeit gegen Terrorismus, Banden und Parallelgesellschaften.
- Unterstützung für Unternehmen beim Schutz vor Cyberangriffen, z. B. durch gezielte Ausbildung und Anlaufstellen.
- Besserer Schutz verletzlicher Personen vor häuslicher Gewalt.
- Hartes Vorgehen gegen Angriffe auf Sicherheits- und Blaulichtorganisationen.
- Verteidigungsfähige, d. h. eine solid finanzierte und modern ausgerüstete Armee.
Bauen vereinfachen – für mehr Wohnraum

Staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt: Staatliches Vorkaufsrecht, rigide Massnahmen zum Mieterschutz, ein weitgehender Denkmalschutz und eine überbordende Bürokratie verhindern den Bau von dringend benötigten Wohnraum und tragen zu höheren Mieten bei. Dagegen wehren wir uns. Wir setzen uns dafür ein, dass Wohnen auch in Zukunft bezahlbar bleibt und sich der Traum vom Eigenheim für mehr Menschen, insbesondere Junge, erfüllen lässt.
Unsere Massnahmen:
- Schnellere und einfachere Verfahren für Baubewilligungen mit weniger Auflagen.
- Flexible (Um-)Nutzung von Büros, Gewerbe und Wohnraum.
- Sinnvolle Verdichtung (Nutzung bestehender Dachstöcke, Aufstockungen, Hochhausbauten) ermöglichen
- Einschränkung des Denkmal- und Lärmschutzes sowie des Verbandsbeschwerderechts
- Bekämpfung des staatlichen Vorkaufsrechts und des überbordenden Mieterschutzes.
- Eigenmietwert abschaffen. Gleichzeitig Härtefälle für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer mildern.
- Einplanung ausreichender Freizeiträume und Grünflächen bei der Siedlungsentwicklung.
- Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Regionen.
- Energievorgaben gegenüber Denkmal- und Ortsbildschutz priorisieren.
Volksinitiative der FDP Stadt Zürich
Am 11. Januar 2024 haben FDP, GLP, SVP und Mitte die städtische Volksinitiative "Mehr Wohnraum durch Aufstockung - quartierverträglich und nachhaltig" lanciert. Am 21. August 2024 kam die Initiative erfolgreich zustande. Nun liegt es in den Händen des Stadtzürcher Stimmvolks, über die Verringerung der Wohnungsnot zu entscheiden.
Immer mehr Menschen wollen in der Stadt Zürich leben, doch der Wohnraum ist knapp. Die Nachfrage hat das Angebot schon lange überholt. Nun braucht es Lösungen, die mit den Zeichen der Zeit Schritt halten – schnell, unkompliziert, preiswert und nachhaltig. Deshalb fordert die städtische Volksinitiative «Mehr Wohnraum durch Aufstockung – quartierverträglich und nachhaltig» eine Anpassung der Bau- und Zonenordnung, so dass bestehende Gebäude in der Stadt Zürich um ein Stockwerk erhöht werden dürfen.
Zuwanderung beschränken – hart, aber fair

Unsere Schulen und Gemeinden stossen aufgrund des hohen Anteils an Migrantinnen und Migranten an ihre Grenzen. Wir setzen uns dafür ein, dass Unternehmen weiterhin unbürokratischen Zugang zu Fachkräften aus aller Welt haben. Gesetzeswidrige Migration hingegen tolerieren wir nicht. Wirtschaftsflüchtlinge und unkontrollierte illegale Einwanderung in unsere Sozialsysteme müssen gestoppt werden. Sozialtourismus ist zu bekämpfen, die Zuwanderung in unser Land zu beschränken und Missstände im Asylbereich zu beheben.
Unsere Massnahmen:
- Eindämmung der illegalen Migration, insbesondere von Wirtschaftsflüchtlingen.
- Konsequente Rückschaffung illegaler und abgewiesener Asylsuchender mit beschleunigten Asylverfahren.
- Verkürzung und Beschränkung des Schutzstatus S, um Missbrauch zu verhindern.
- Bei der Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit mit der EU braucht es ein griffiges Schutzkonzept zur Steuerung und Reduktion der Zuwanderung aus der EU.
Siehe auch, Positionspaper Migration der FDP Schweiz:

Wir sind angewiesen auf genügend Strom aus unterschiedlichsten Quellen. Energieengpässe oder gar Blackouts hätten verheerende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen und müssen verhindert werden. Die Versorgungssicherheit ist jederzeit zu gewährleisten.
Unsere Massnahmen:
- Vereinfachte Verfahren und Anreize für den Einsatz von Innovationen (Technologieoffenheit).
- Förderung der Winterstromproduktion mit dem Ausbau der Wasserkraft und, als ergänzende Massnahmen, auch der Solarenergie und der Windkraft. Windräder sollen an geeigneten Standorten nur nach sorgfältiger Interessenabwägung errichtet werden.
- Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, solange die Sicherheit gewährleistet ist, und den Bau von Atomkraftwerken der neuen Generation prüfen.
- Alle Energieformen sollen langfristig wirtschaftlich selbsttragend sein.
- Unternehmen tragen mit ihren innovativen Investitionen viel für den Ausbau energieeffizienter, erneuerbarer Energien bei, was nicht durch unnötige behördliche Auflagen behindert werden soll.
Siehe auch, Positionspapier Stromversorgungssicherheit der FDP Schweiz:
https://www.fdp.ch/positionen/umwelt-verkehr-energie-und-kommunikation/stromversorgungssicherheit
Hochstehende und bezahlbare Gesundheitsversorgung

Die Gesundheitskosten explodieren und die Prämien steigen immer weiter. Das muss ein Ende haben. Dafür müssen die Ursachen angegangen werden. Gleichzeitig wollen wir allen Menschen eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung sichern.
Unsere Massnahmen:
- Ambulant vor stationär in den Spitälern und Erleichterungen für Hausärzte zur Senkung der Kosten für alle.
- Digitalisierungsoffensive für ein elektronisches Patientendossier, vereinfachte Kommunikation mit den Behörden, Verhinderung von Doppelspurigkeiten bei den medizinischen Behandlungen etc.
- Gebühr für Notfallstationen bei Bagatellfällen verlangen.
- Reduktion der Anzahl Spitäler, zugunsten von regionalen ambulanten Versorgungszentren.
- Grossregionale statt kantonale Planung der Spitalkapazitäten.
- Keine Ausweitung der Prämienverbilligungen.
- Begrenzung des Leistungskatalogs in der Grundversicherung auf das medizinisch Notwendige. - Neue Versicherungsmodelle schaffen (z. B. nur mit Franchise oder mehr Leistungsstufen).
- Einheitskasse ablehnen.
Mobilität im Kanton Zürich – reibungslos und zukunftsorientiert

Mobilität ist grundlegend für unser Leben und muss zukunftsorientiert gestaltet werden. Statt auf Verbote und Einschränkungen zu setzen, fordern wir die freie Wahl des Verkehrsmittels.
Unsere Massnahmen:
- Technologieoffene Weiterentwicklung der CO2-armen Mobilität aller Verkehrsträger (ÖV, Individualverkehr, Güterverkehr, Luftverkehr, Velo etc.), bspw. durch die Elektrifizierung der Verkehrsträger oder mittels E-Fuels.
- Flughafen Zürich als Drehkreuz mit Direktverbindungen zu den wichtigsten Metropolen für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums Zürich erhalten.
- Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur besseren Vernetzung von Stadt, Land und Agglomeration – mit mehr Mitspracherecht der Gemeinden.
- Sicherstellung der Zugänglichkeit und Erreichbarkeit der urbanen Zentren durch alle Verkehrsträger.
- Gleichberechtigtes Nebeneinander aller Verkehrsträger als Voraussetzung für einen attraktiven und wettbewerbsfähigen Kanton.
- Verkehr innerorts nicht ausbremsen: Tempo 50 auf den Hauptachsen und Tempo 30 in den Quartieren.
- Weniger Lärm für die Wohnbevölkerung durch den Einbau von Flüsterbelägen.
- Bau von Ladestationen für E-Mobilität im öffentlich zugänglichen Raum erleichtern.
- Entlastung von Ortschaften durch den Bau von Umfahrungen und der Fertigstellung Oberlandautobahn (A15).
- Urbane Mobilität und Zukunftstrends (bspw. autonomes Fahren) fördern und nicht durch Auflagen und Bürokratie ausbremsen.
Mehr zu diesem Thema kannst du auch in der Resolution der FDP Urban nachlesen:
Damit in Zürich niemand stehen bleibt! - Die ÖV-Initiative wurde eingereicht und ist zustandegekommen!

18. November 2022: Sechs Monate nach Lancierung der «ÖV-Initiative – Damit in Zürich niemand stehen bleibt» haben Mitglieder des Initiativ-Komitees der FDP und SVP über 7'000 Unterschriften eingereicht. Ziel der Volksinitiative ist es, den ÖV nicht zu verlangsamen, sondern dass er weiterhin im ganzen Kanton Zürich attraktiv bleibt.
Wie geht es weiter:
Die kantonale Volksabstimmung ist voraussichtlich für das Jahr 2025 geplant.
Nein zu Tempo 30 für den ÖV auf Hauptverkehrsachsen:
- Flächendeckendes Tempo 30 für den ÖV kostet die Bürgerinnen und Bürger viel Zeit und den ÖV viel Geld
- Der ganze Kanton ist von den Einschränkungen durch Tempo 30 beim ÖV 30 betroffen: ÖV funktioniert als Netz und Städte übernehmen Zentrumsfunktion
- Mobilität bedeutet einen grossen Nutzen für alle
Umwelt schützen – nachhaltig für die nächste Generation

Mit einem wirksamen Schutz der Umwelt sichern wir attraktive Lebensräume in unserem Kanton. Unsere Verantwortung gegenüber der nächsten Generation verpflichtet uns, die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten.
Unsere Massnahmen:
- Marktwirtschaftliche Massnahmen sind Grundpfeiler einer nachhaltigen Politik: Wir arbeiten deshalb mit Anreizen statt mit Verboten.
- Mehr Kostenwahrheit beim Verbrauch natürlicher Ressourcen.
- Staatsquotenneutrale Anreizsysteme statt Verbote und Vorschriften zur Reduktion des CO2- Ausstosses.
- Konsequentes Durchsetzen des Verursacherprinzips.
- Forschungs- und Innovationskraft von Hochschulen und Unternehmen stärken statt Umweltbürokratie ausbauen.

Gemeindeautonomie und ein gesunder Wettbewerb zwischen den Gemeinden schaffen bessere Lösungen.
Unsere Massnahmen:
- Aufgabenentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden.
- Regelmässige Überprüfung des Finanzausgleichs, inklusive der besonderen Ausgleichsgefässe wie dem Zentrumslastenausgleich.
- Die Gemeinden sollen über die Möglichkeit verfügen, für Bewohner und Unternehmen unterschiedliche Steuerfüsse festzulegen.
Wer vertritt die FDP Kanton Zürich kantonal und national?
Kantonal:
Kantonsrat (Parlament) (Legislative)
- Die FDP Kanton Zürich hält aktuell im Kantonsparlament 30 von 180 Sitzen. Hier geht es zu den Mitgliedern.
Regierungsrat (Exekutive)
- Im Regierungsrat des Kantons Zürich ist die Partei von 2019 - 2023 mit Carmen Walker Späh vertreten. Carmen Walker Späh wurde am 12. Februar 2023 als FDP-Regierungsrätin wiedergewählt.
National:
Ständerat (Parlament/Legislative - kleine Kammer)
- Von insgesamt 46 Sitzen verfügt die FDP-Fraktion über 12 Sitze im Ständerat. Hier geht es zu den Mitgliedern.
Nationalrat (Parlament/Legislative - grosse Kammer)
- Im Nationalratssaal hält die FDP für den Kanton Zürich 5 von insgesamt 200 Sitzen und ist mit den freisinnigen Nationalräten Andri Silberschmidt, Beat Walti, Bettina Balmer, Hans-Peter Portmann und Regine Sauter vertreten.
Mehr Informationen zur Gewaltenteilung findest Du hier.
Wofür ist der Regierungsrat (Exekutive) zuständig und wer ist dies im Kanton Zürich?

Der Regierungsrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des Kantons (die Exekutive). Er wahrt die Verfassung und setzt die Gesetze, Verordnungen und die Beschlüsse des Kantonsrates um. Der Regierungsrat besteht aus sieben Mitgliedern:
- Carmen Walker Späh (Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion - Parteizugehörigkeit: FDP)
- Ernst Stocker (Präsident und Vorsteher der Finanzdirektion - Parteizugehörigkeit: SVP)
- Mario Fehr (Vizepräsident und Vorsteher der Sicherheitsdirektion - Parteizugehörigkeit: Parteilos)
- Dr. Silvia Steiner (Vorsteherin der Bildungsdirektion - Parteizugehörigkeit: die Mitte)
- Jacqueline Fehr (Vorsteherin der Direktion der Justiz und des Innern - Parteizugehörigkeit: SP)
- Natalie Rickli (Vorsteherin der Gesundheitsdirektion - Parteizugehörigkeit: SVP)
- Dr. Martin Neukom (Vorsteher der Baudirektion - Parteizugehörigkeit: Grüne)